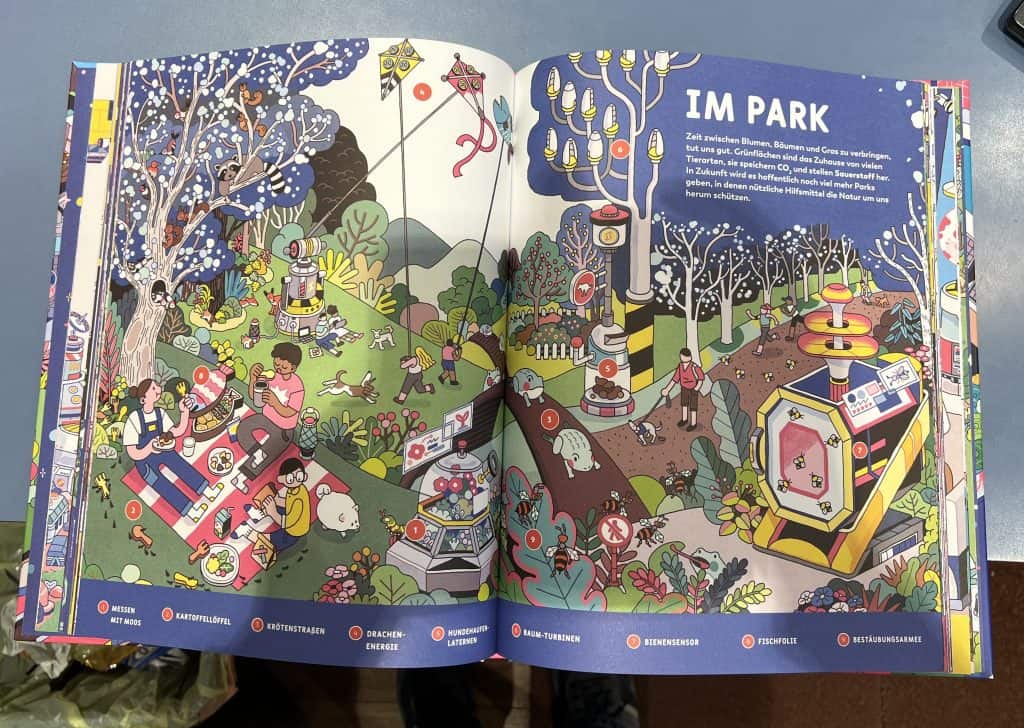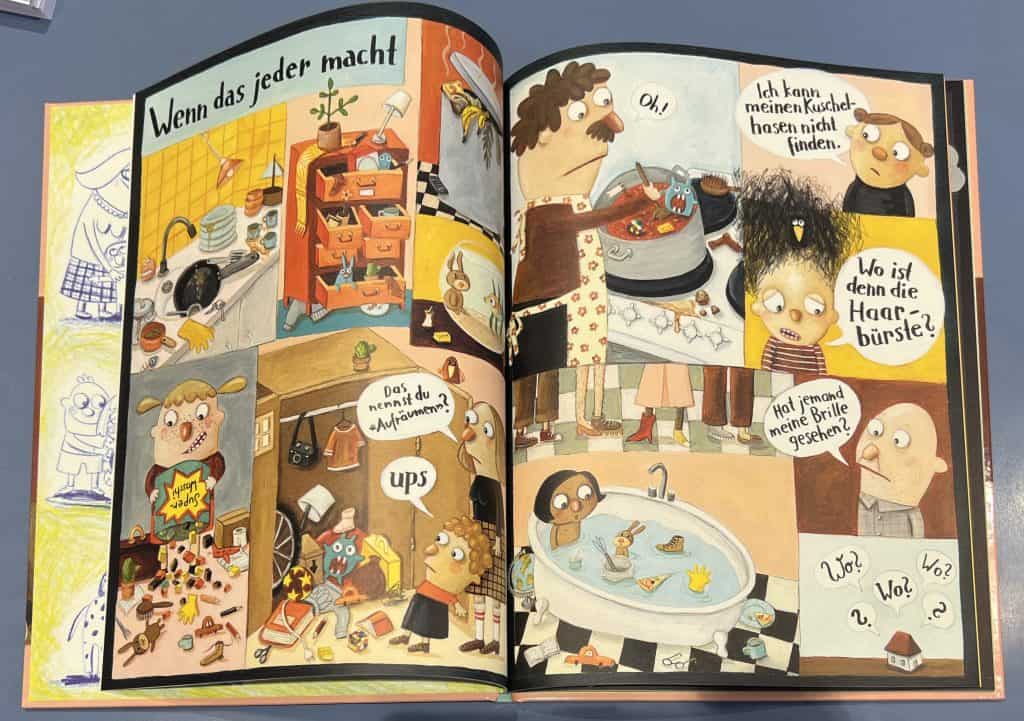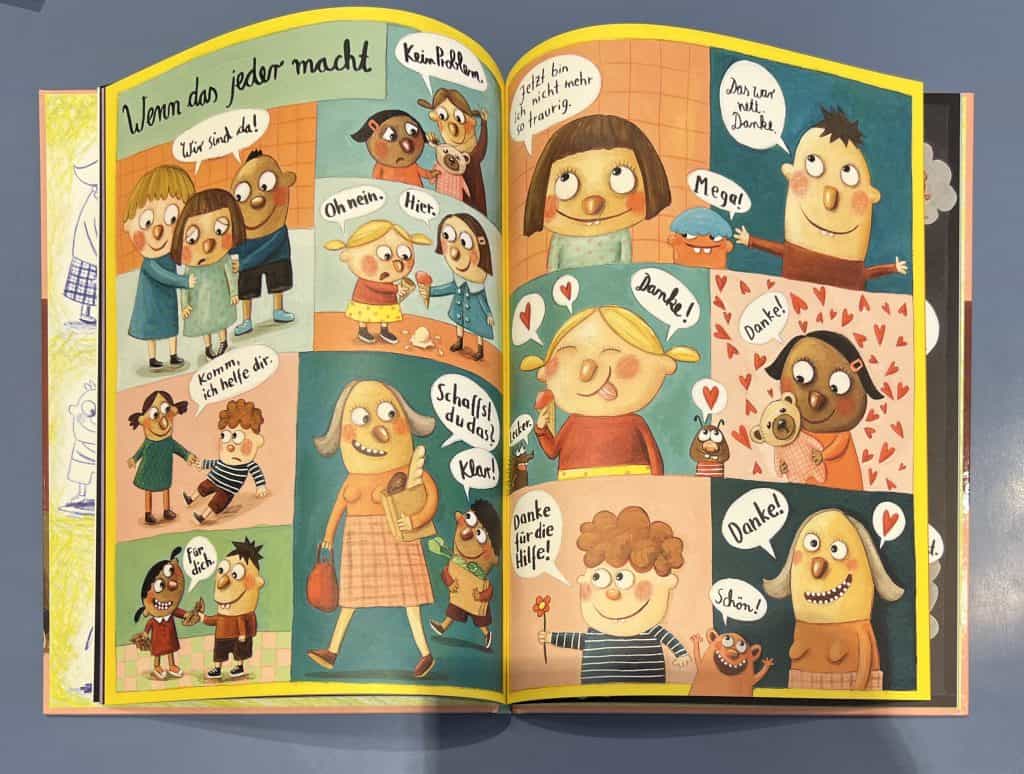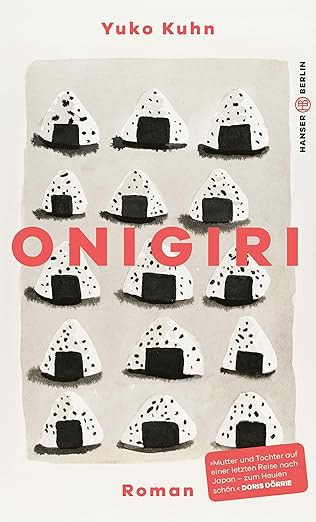Heute erscheint im Kösel Verlag das neue Buch des Duisburger Kabarettisten Wolfgang Trepper.

Ich las dieses Buch aus Neugier, denn Wolfgang Trepper ist in Rheinhausen aufgewachsen und besuchte immer mal wieder meine Buchhandlung. Dort lernte ich ihn als sehr höflichen, fast schüchternen jungen Mann kennen. Irgendwann kam er nicht mehr, er war weggezogen und ich verlor ihn aus den Augen. Einige Jahre später sah ich ihn dann bei einer seiner Vorstellungen wieder und ich konnte kaum glauben, dass das Wolfgang Trepper war. Sein „harsches“ Auftreten war für mich sehr überraschend und ich erhoffte mir, in dem Buch ein paar Erklärungen zu finden, wie es zu dem Sinneswandel gekommen war.
Um es vorweg zu nehmen: Ich habe mit dem Buch aus verschiedenen Gründen herzerwärmende Lesestunden verbracht und empfehle es ohne wenn und aber.
Warum? Da geht es, wie man schon im Untertitel lesen kann, um Tante Henny. Ihr hat Wolfgang Trepper viel zu verdanken. Sie wurde zur Ersatzmutter, als die eigene Mutter immer häufiger ins Krankenhaus musste und der berufstätige Vater mit der Erziehung seiner beiden Söhne überfordert war. Tante Henny- ich habe sie auch sofort lieben gelernt. Sie war bodenständig, sagte, was sie dachte und das war fast immer sehr vernünftig und obwohl sie und ihr Mann, der Oheim, nicht viel Geld hatten, machten sie aus dem Leben ein Fest und freuten sich an kleinen Dingen wie Bolle. Eine bessere Lebenslehrmeisterin konnte Wolfgang Trepper nicht haben und das weiß er bis heute.
Seinen Lebenslauf beschreibend, taucht man in dem Buch zuerst in Duisburger Welten in den 80er und 90er Jahren ein. Trepper arbeitete bei Krupp, sehr ungern, so dass er sich immer mehr für den Rheinhauser Handball Verein OSC engagierte und dabei war, als der OSC in die Bundesliga aufstieg. War er schon zum OSC eher durch Zufall gekommen, sollten noch weitere Zufälle in seinem Leben folgen, die Trepper immer, nach Beratung mit Tante Henny, genutzt hat, um sich weiterzuentwickeln und Neues auszuprobieren. Das lobe ich mir.
Er kam zu Radio DU und das war seine wahre „Arbeitsheimat“. Der Programmdirektor war offen für die ausgefallenen Programmideen und Kommentare von Trepper, ja, stachelte ihn sogar an, noch „ durchgeknallter“ zu werden. Irre Jahre, denn beim Radio war Spontanität das A und O.
Aber ganz langsam suchte sich nach einigen Jahren eine andere Passion ihren Weg in Treppers Kopf: Der Auftritt auf der Bühne! Und wieder war Kollege Zufall vor Ort, denn Corny Littmann, Inhaber des legendären Schmidt Theaters in Hamburg, wurde auf Trepper aufmerksam und nahm ihn unter seine Fittiche. Es ging immer steiler aufwärts mit seiner Karriere als Kabarettist, so dass er beim Radio kündigte, nach Hamburg zog und dort seitdem mit Frau und Tochter lebt. ( Aber noch eine kleine Wohnung in Duisburg hat, weil hier eben seine Heimat ist).
Ja und da ist er nun, der Wolfgang Trepper mit seinen 64 Jahren. Hat alles erreicht, kann stolz auf sich sein, auch auf seine Projekte in Afrika, für die er nach jedem Auftritt sammelt. In dem Buch lernt man einen Mann kennen, der kritisch über sich und sein Leben nachdenkt und man erfährt, dass er privat immer noch ein ruhige Mensch ist, der sich um Harmonie bemüht.