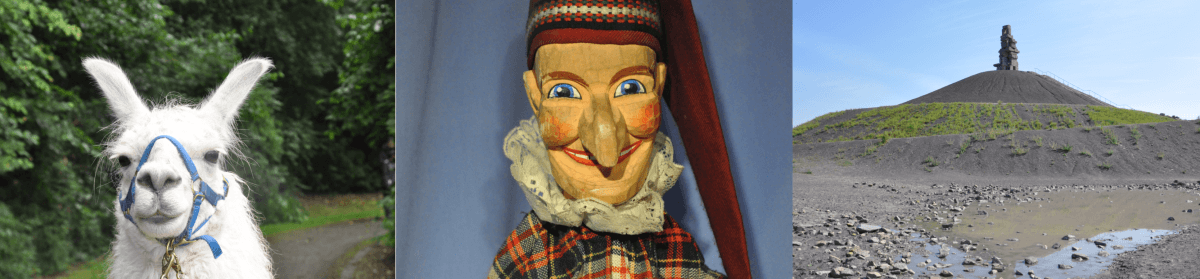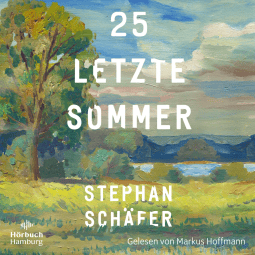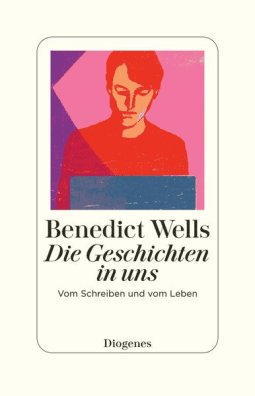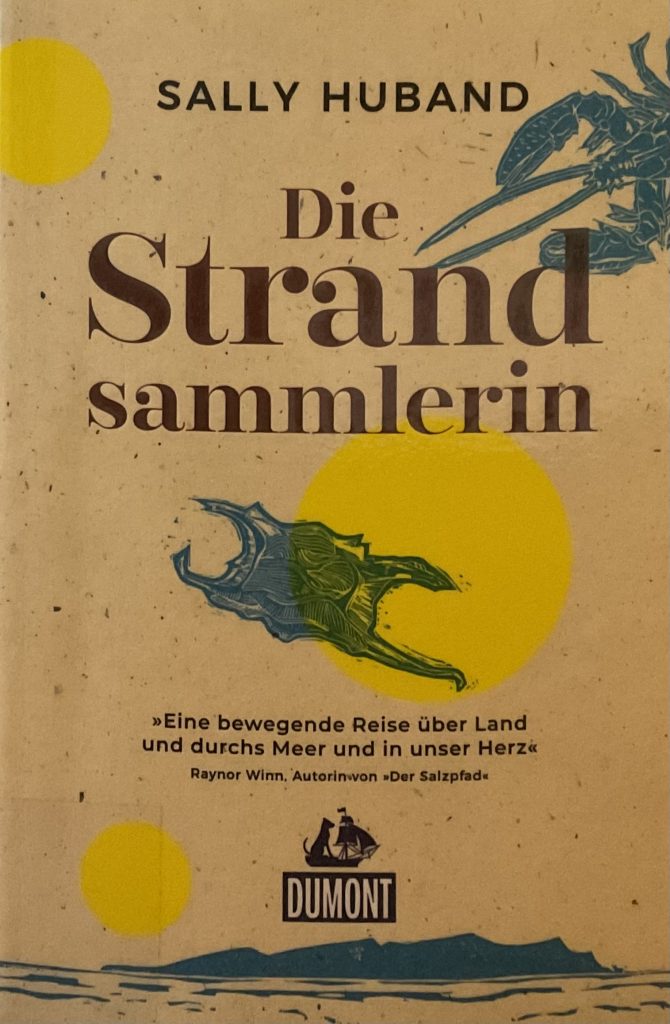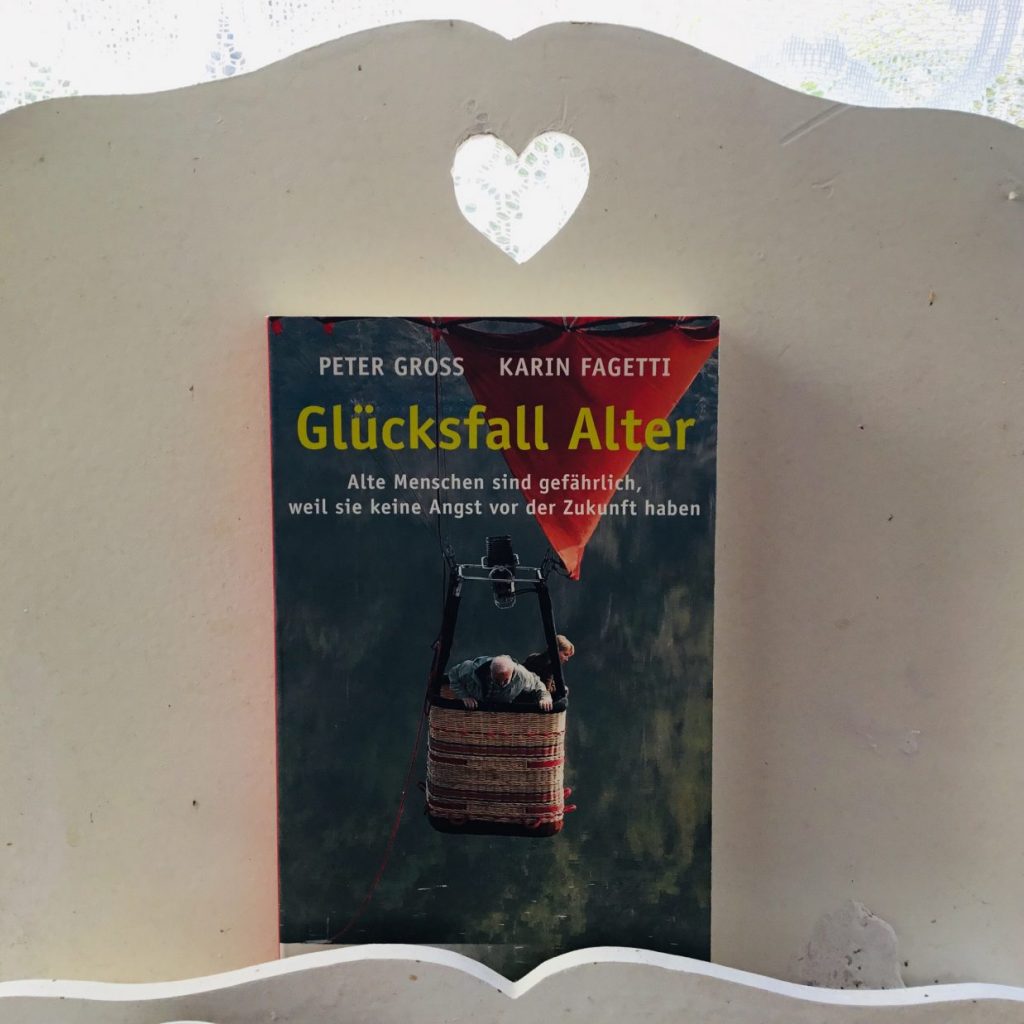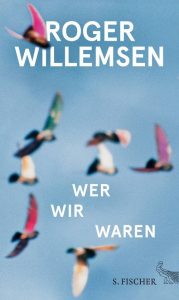Über die Feiertage habe ich mir die neun Podcastfolgen der Astrid-Lindgren-Schule in Mülheim angehört.

Frank Zepp Oberpichler aus Duisburg produziert diese Podcasts und interviewt pro Folge jeweils ca. eine halbe Stunde lang ein Kind aus der Grundschule. So lernt man z.B. Oleh aus der Ukraine kennen. Er erzählt, wie er aus der Ukraine nach Deutschland kam und kein Deutsch sprach. Es war schwer, Freunde zu finden, sich nicht ausdrücken zu können und manchmal hatte er deswegen sogar Angst. Aber er tat alles dafür, schnell die Sprache zu lernen und steht jetzt vor dem Schulwechsel auf das Gymnasium.
Oder lernen Sie den Träumesuperhelden Rayyan aus der vierten Klasse kennen. Wie stellt er sich seine Zukunft vor?
Aus der dritten Klasse wird Johanna interviewt. Sie gehört zum Kinderparlament der Schule und kann erste Erfahrungen in demokratischem Handeln sammeln. Mich hat es beeindruckt, dass ihr ein friedliches Miteinander das Wichtigste ist.
Den Kindern zuzuhören, das tut gut und die eigene Weltsicht wird erweitert. Wer dafür offen ist, hier geht es zu den neun Folgen:
https://kindern-eine-stimme-geben.podigee.io/
Beim Zuhören kam ich ins Grübeln. Wie wird Kindern in Duisburg eigentlich eine Stimme gegeben? Ich habe mich im Internet mal auf die Suche gemacht und fand Hinweise auf ein Jugendparlament im Jahr 2009 und ein Kinderparlament im Jahr 2019. Und dann entdeckte ich vom Jugendring der Stadt Duisburg e.V. die Jugendbotschaft Duisburg u.a. mit einer Meinungswand und Ratspatenschaften.


Auf den ersten Blick ganz toll, aber beim näheren Hinsehen entdeckte ich, dass der letzte „aktuelle“ Eintrag von 2023 ist. In „Über uns“ ist der Text von 2021 und es geht u.a. auch um die Finanzierung des Projekts. Auf Instagram gibt es einen Jugendbotschaft-Account, dessen letzter Post im Februar ein Aufruf zum Wählen ist.
Leider habe ich nirgendwo Informationen entdeckt, was die Ergebnisse aus den Ratspatenschaften sind und ob dokumentiert wird, inwieweit die Meinungswand in irgendeiner Form einen Einfluss auf politische Entscheidungen hat.
Eine aktuelle Möglichkeit für Kinder und Erwachsene, sich zu der Zukunft Duisburgs zu äußern, ist diese Umfrage von der Stadt Duisburg:
https://beteiligung.nrw.de/portal/Duisburg/beteiligung/themen/1013291
Gibt es darüber hinaus noch andere Aktionen der Stadt Duisburg, um Kinder und Jugendliche politisch teilhaben zu lassen?
Wäre ein Podcast ein erster Schritt?
Wie sieht es in anderen deutschen Städten aus? Wie werden dort Kinder in politische Entscheidungen einbezogen?
Das würde mich sehr interessieren.