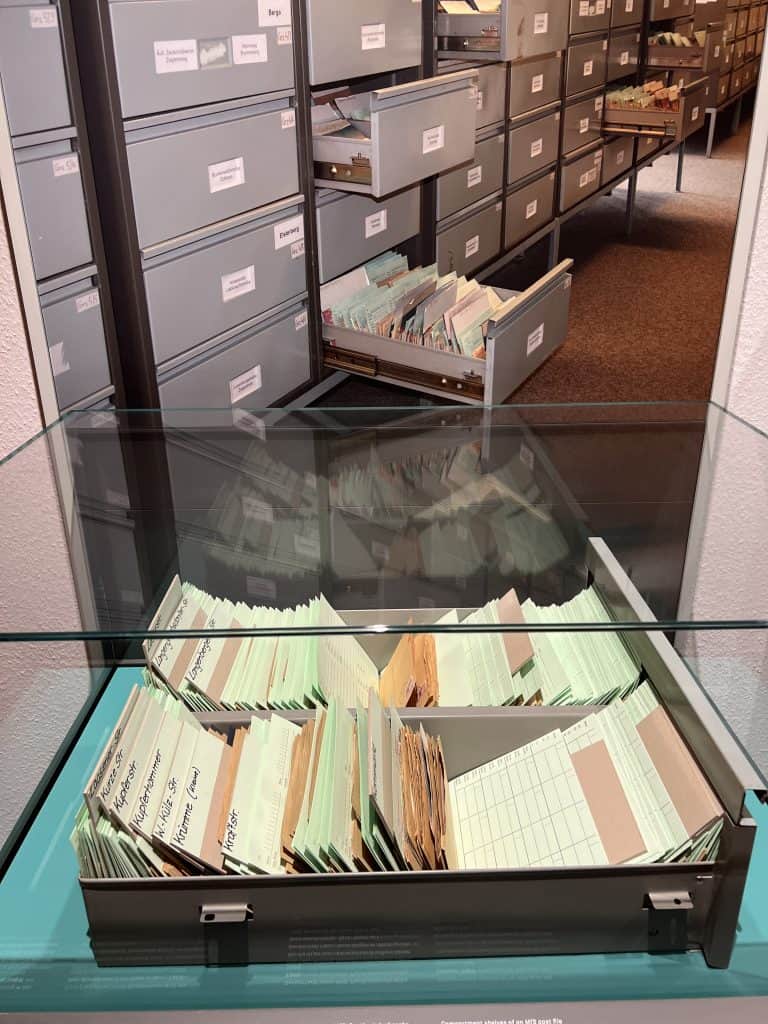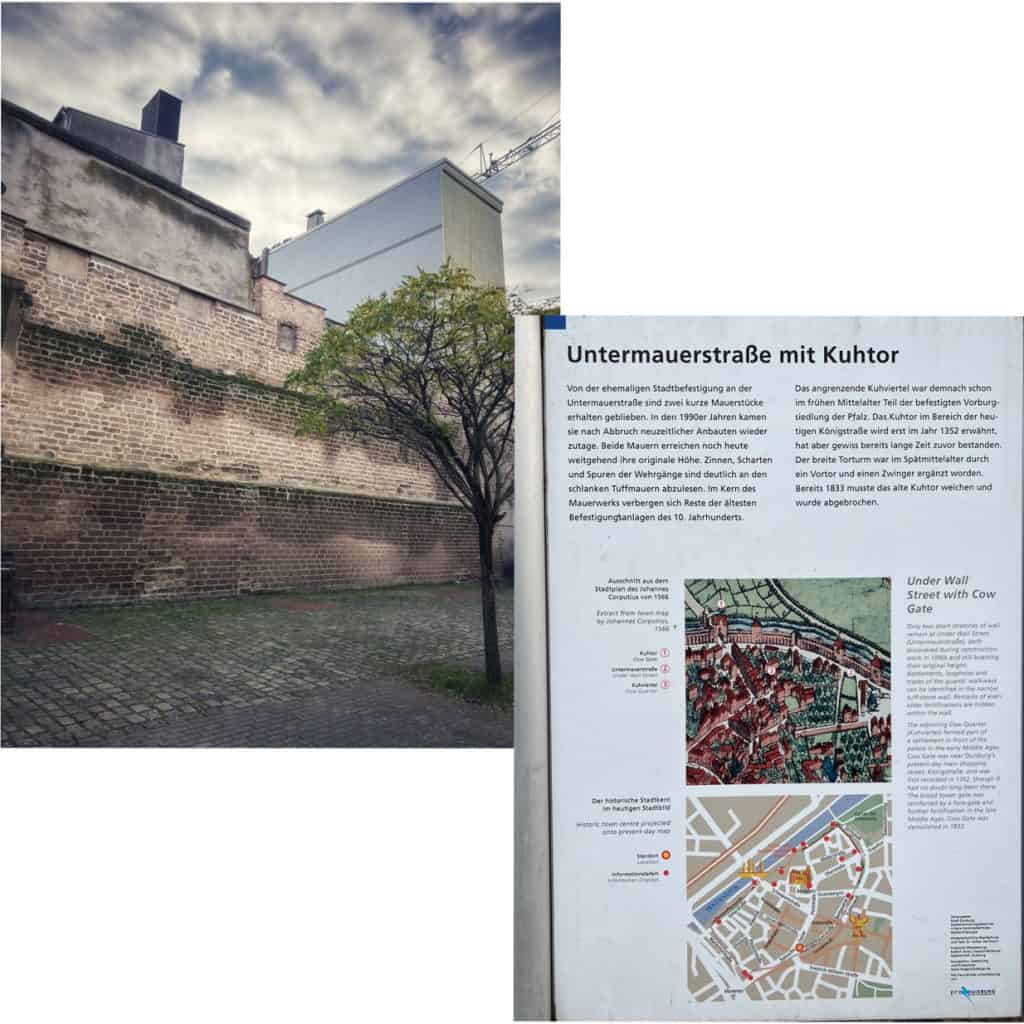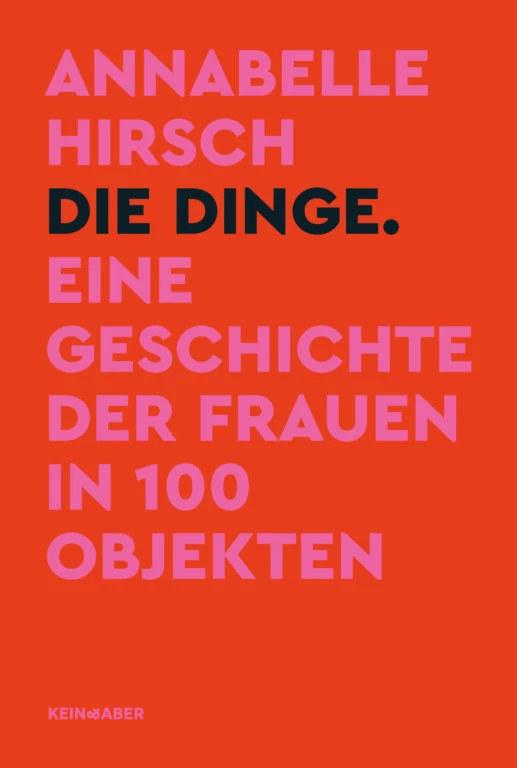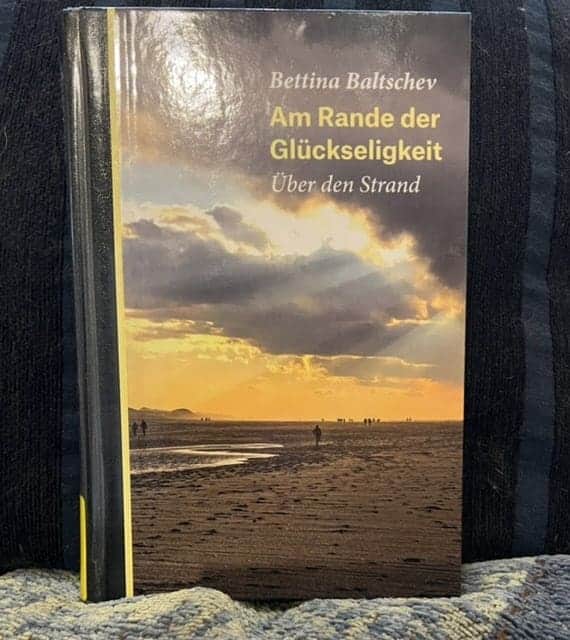Neben Grönland hat Donald Trump auch den Panamakanal im Visier und forderte den Wunsch, dass der Panamakanal wieder der USA gehört. Da passt es doch ausgezeichnet, dass im Hanser Verlag im Frühjahr dieses Buch über den Bau des Panamakanals erschienen ist:

Bereits im 19. Jahrhundert hatten französische Ingenieure versucht, in Panama einen Kanal zwischen Atlantik und dem Pazifischen Ozean zu bauen, scheiterten aber an technischen und vor allen Dingen an gesundheitlichen Problemen. Geldfieber und Malaria töteten viele Arbeiter und die Erschließung musste eingestellt werden.
Anfang des 20. Jahrhunderts haben sich die Voraussetzungen verbessert. Inzwischen engagiert sich die USA in Panama, das zu der Zeit noch zu Kolumbien gehört, es gibt eine Eisenbahnstrecke, das Gelbfieber hat man im Griff und ein junger Arzt, John Oswald will auch vor Ort die Malaria durch bessere Hygienebedingungen bekämpfen. Er und seine Frau gehören zu den Romanfiguren, die die Geschichte des Kanals lebendig werden lassen. Der Fischer Francesco und Sohn Omar, die das Für und Wider zum Kanalbau, die Vergangenheit und die Zukunft, repräsentieren, sowie das junge Mädchen Ada von Barbados, das in Panama Arbeit sucht, um Geld für die Operation ihrer Schwester zu verdienen, gehören ebenfalls zu den Protagonisten. Aber in dem Roman wird nicht nur über das Alltagsleben im Kanalgebiet erzählt, viele kleine und ebenso bedeutende Geschichten gruppiert die Autorin um das Hauptthema. Leise Liebesgeschichten werden erzählt und es geht auch um Themen wie „Arm und Reich“, „Rassismus“, „Unterdrückung von Frauen“ oder „Politisches Handeln der Bevölkerung“. Der große Riss in der Gesellschaft im übertragenden Sinne.
Ich habe das Buch gerne gelesen. Es ist ein Kaleidoskop menschlicher Glücksmomente, Liebe, Sorgen, Ehrgeiz, Kämpfe, eben wie das Leben so ist.
Ach ja, der US-Präsident Jimmy Carter unterschrieb einen Vertrag, der besagt, dass ab dem Jahr 2000 der Kanal dem Staat Panama gehört. Nur für den Fall, dass Herr Trump etwas anderes behauptet.