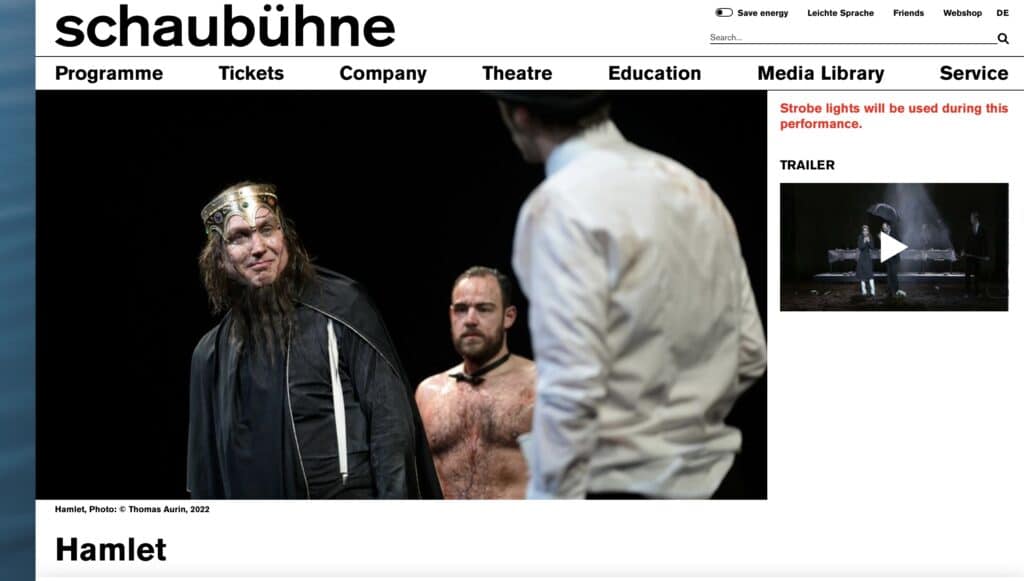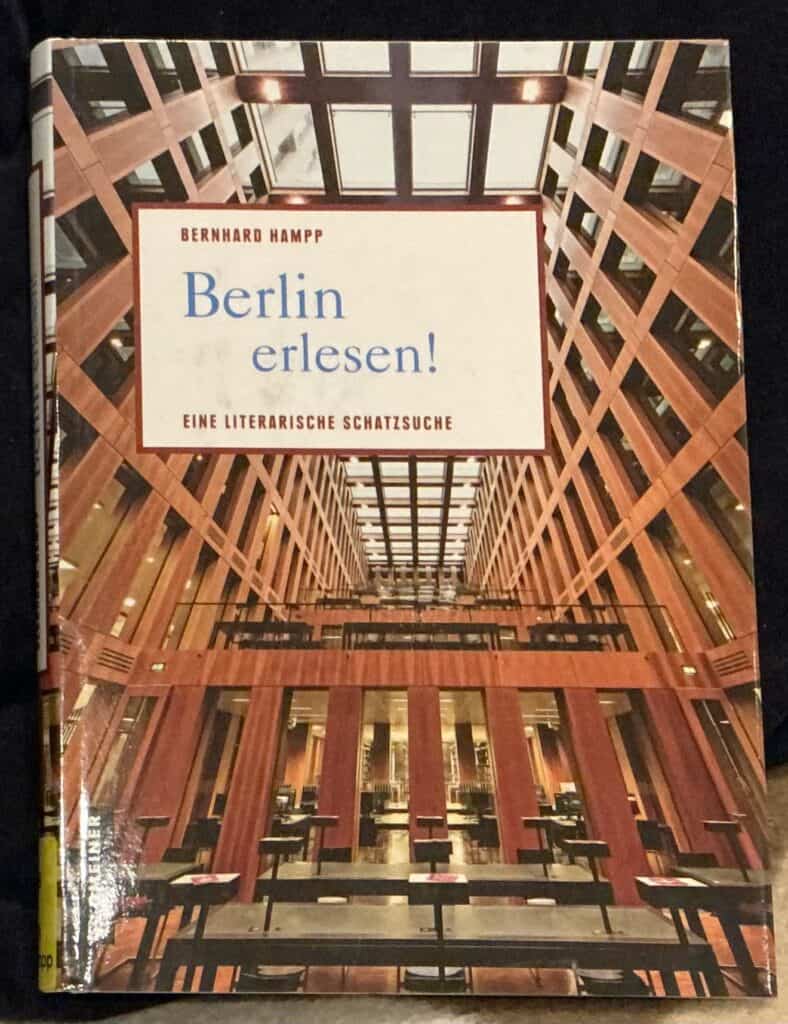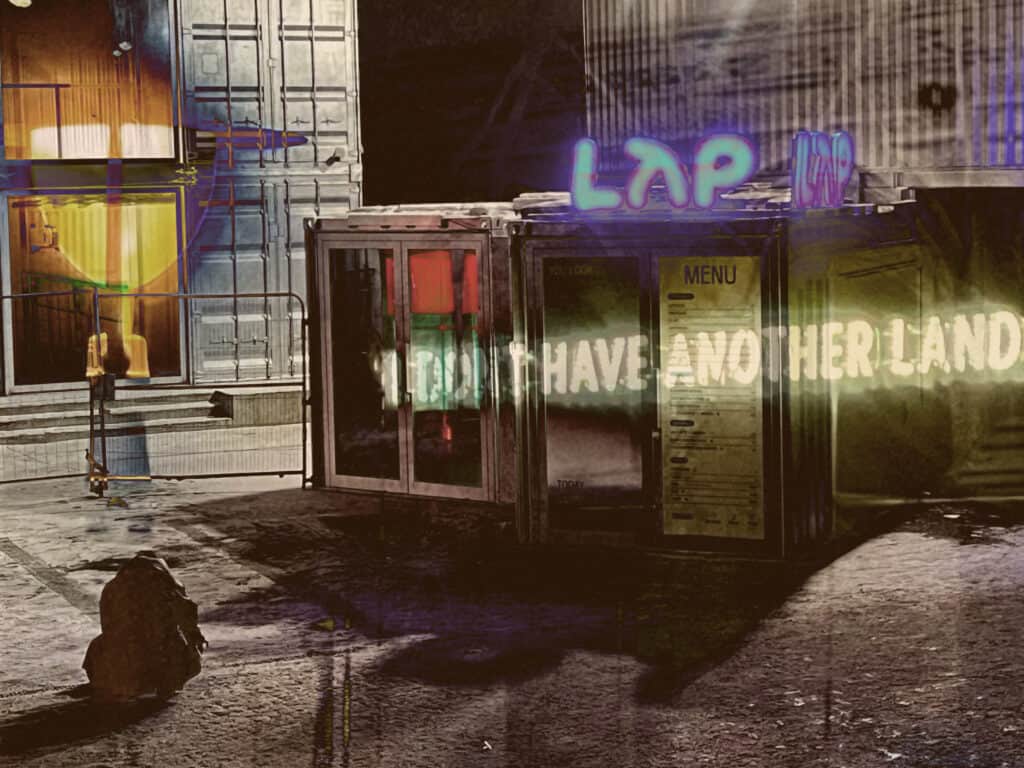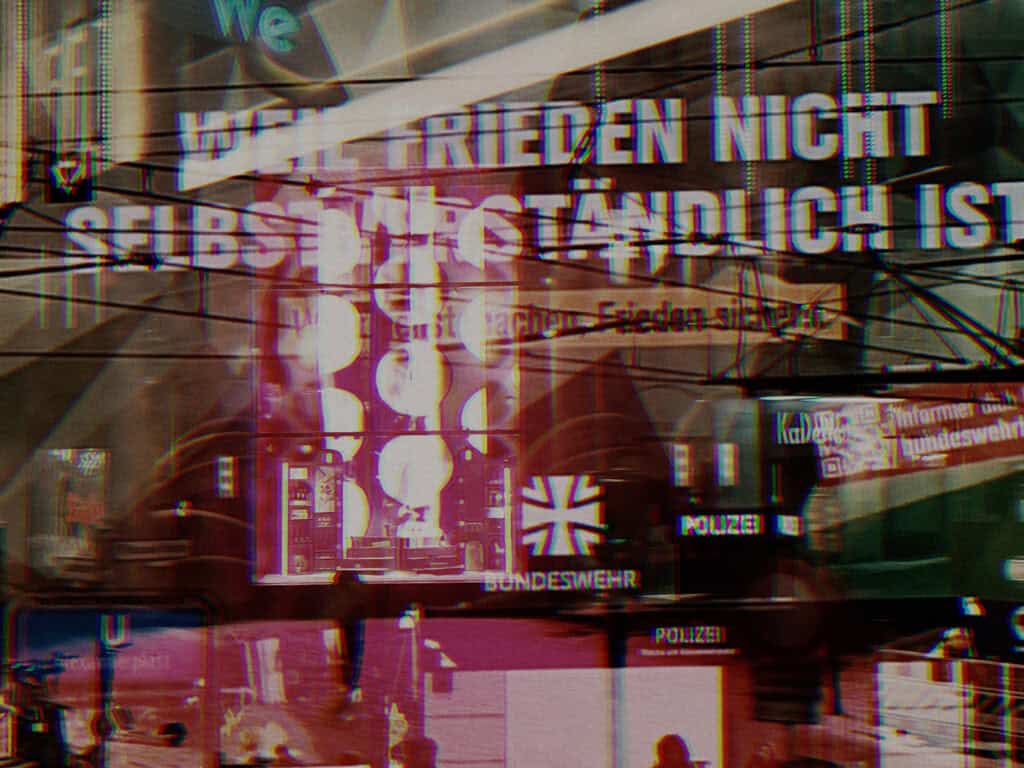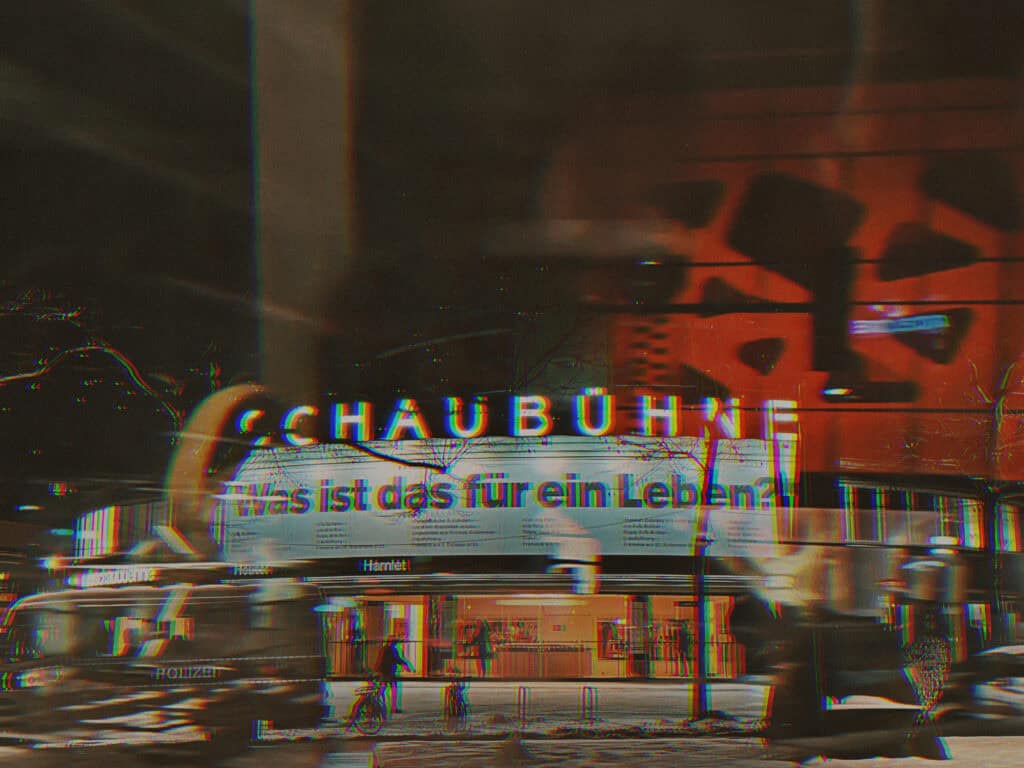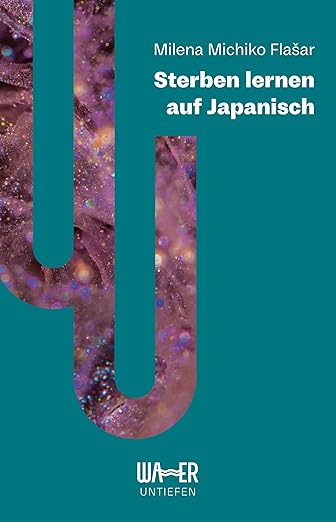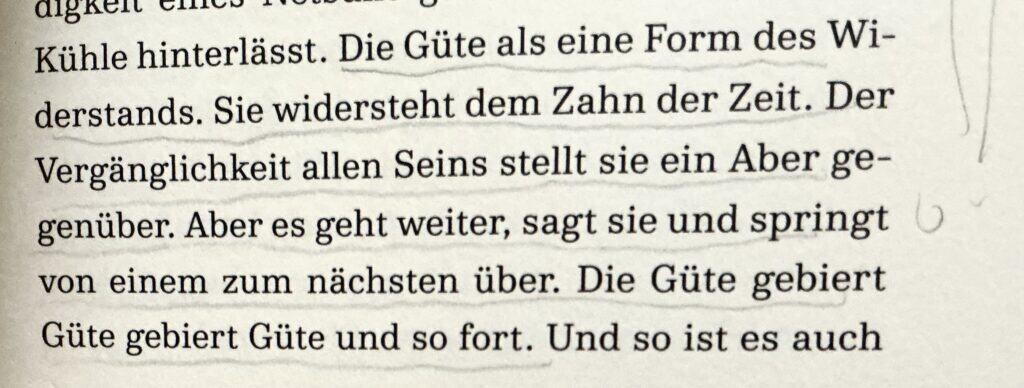Letzte Woche diskutierte ich mit einer Bekannten über des Wandel der deutschen Sprache. Sie ist keine Freundin des zunehmenden Gebrauchs von Wörtern, die aus der englischen Sprache kommen. Ich gebe zu, dass ich manchmal auch meine Schwierigkeiten habe, die Bedeutung zuzuordnen. ( z.B. Unhinged, yappen, Yassification, slayen- Auflösung am Ende des Textes).
Winkte mir das Schicksal zu, als ich einen Tag später zufällig in einem Bücherschrank dieses Buch fand?
Ungefähr 1000 Wörter werden aufgelistet, die Goethe in seinen Werken benutzt hat. Das Wort „merkwürdig“ im Titel ist dabei dreideutig, denn in diesem Buch kann man Wörter entdecken, die aus heutiger Sicht seltsam, da vergessen, sind oder es gibt Wörter, die man sich merken kann, überraschen diese doch dadurch, dass wir sie heute zwar noch benutzen, aber dies mit einer ganz anderen Bedeutung. Merkwürdig sind dann auch noch diese Wörter, die Goethe sich quasi ausgedacht hat und die wir heute noch anwenden.
Ich gebe Ihnen gerne ein paar Beispiele. Bei jedem Wort gibt es im Buch mindestens ein Textbeispiel aus seinen Werken oder Briefen.
Von Goethe ausgedachte Wörter:
Anmut, bedenklich, Behagen, betrübt, Diät, Fabrik, Hosenscheißer, Kapitalist, lallen, Vorsatz, schauderhaft, Schicht machen
Wörter, die heute eine andere Bedeutung haben:
„dreist“ war früher positiv besetzt und meinte mutig oder beherzt
“Durchschnitt“ = Durchquerung (Er machte einen Durchschnitt des Gartens)
“Elend“ = Fremde, Heimatlosigkeit. Zitat aus dem Theaterstück „Hermann und Dorothea“: Streifen nicht herrliche Männer von hoher Geburt nun im Elend?“
„Extremität“ = Notlage Zitat aus „Götz von Berlichingen“: „Achtest du meinen Mann so wenig, dass du in dieser Extremität seine Hilfe verschmähst?“
“feiern“ = Nichts tun, ausruhen
“kompromittieren“ = jemanden zum Schiedsrichter wählen
„Penetration“ = Scharfsinn, Einsicht
“schmeicheln“ = lindern, mildern
Untergegangene Wörter und Redewendungen:
abmüßigen- Mußezeit erübrigen — Für 2026 nahm er sich vor, mindestens drei Stunden am Tag für seine Lifebalance abzumüßigen.
Affabilität- Umgänglichkeit, Leutseligkeit — Die Affabilität des neuen Chefs entsprach nicht den Vorstellungen seiner Angestellten, er war ein Muffelkopp.
Blumist/in- Blumenliebhaber/in — Bei dem Speed-Dating erzählte sie ihm, dass sie eine Blumistin sei. Er kannte den Ausdruck nicht und war erst einmal impressed.
düttig- einfältig — Sie zeigte mir stolz ihre neue Duttfrisur und erzählte dann etwas düttig, dass die Hairstylistin gesagt hätte, dass die Duttfrisur sie zehn Jahre jünger mache.
kannegießern – ohne großen Sachverstand über Politik diskutieren
Lappsack – antriebsloser Mensch — Im November begegnet man öfter Lappsäcken, die nicht aus den Puschen kommen, weil die trübe Jahreszeit sie triggert.
Murmelchen – kleines Kind — Ein Gruppe von 25 Murmelchen kam ins Schwimmbad und die schwimmende Silvergeneration hatte den Eindruck, dass ein Sack Flöhe ins Schwimmbecken sprang.
propalieren – ausplaudern, unter die Leute bringen — Wenn er diese Neuigkeit auf Social Media propalieren würde, würden seine Followerzahl explodieren.
Rätzel – Der frühere Finanzminister Theo Waigel war ein Rätzel….Er hatte zusammengewachsene Augenbrauen!
vervitzen/turlupinieren – Ich hoffe, dass ich Sie mit diesen Wörtern und Beispielsätzen nicht zu sehr vervitzt oder turlupiniert habe! (vervitzen= verwirren, turlupinieren = foppen)
Auflösung:
Unhinged= völlig übertriebenes Verhalten
yappen= Übermäßig quatschen oder tratschen
Yassification= etwas übertrieben glamourös machen, loben, dramatisieren
slayen= etwas sehr gut machen