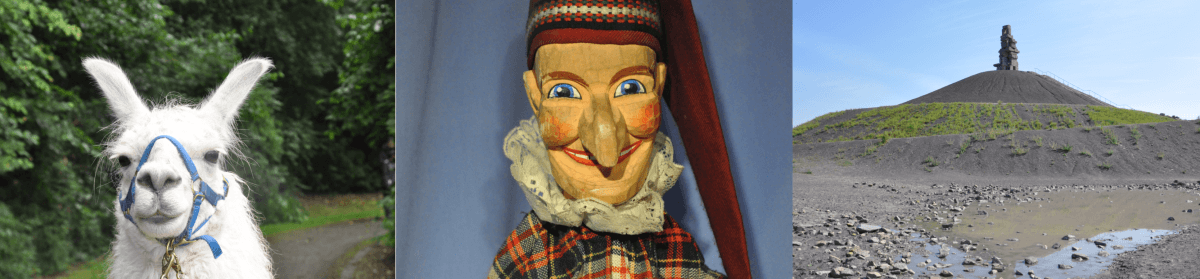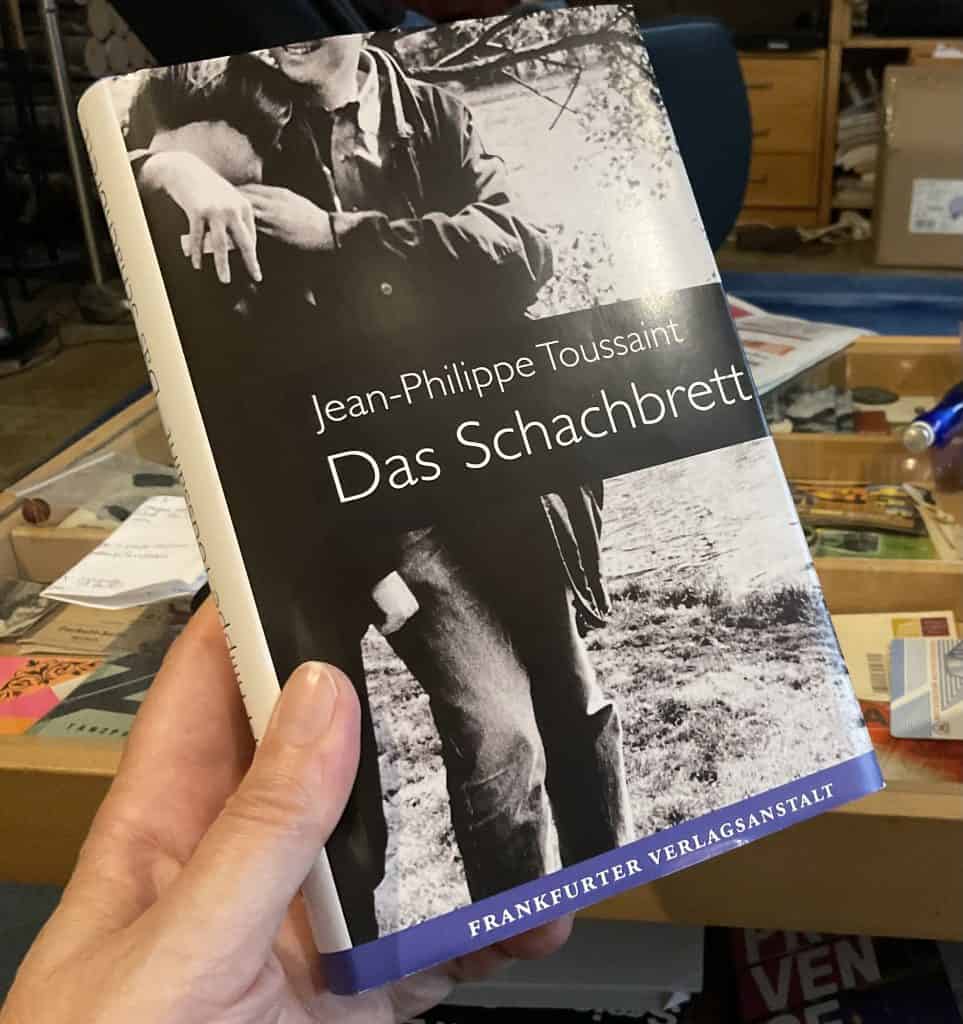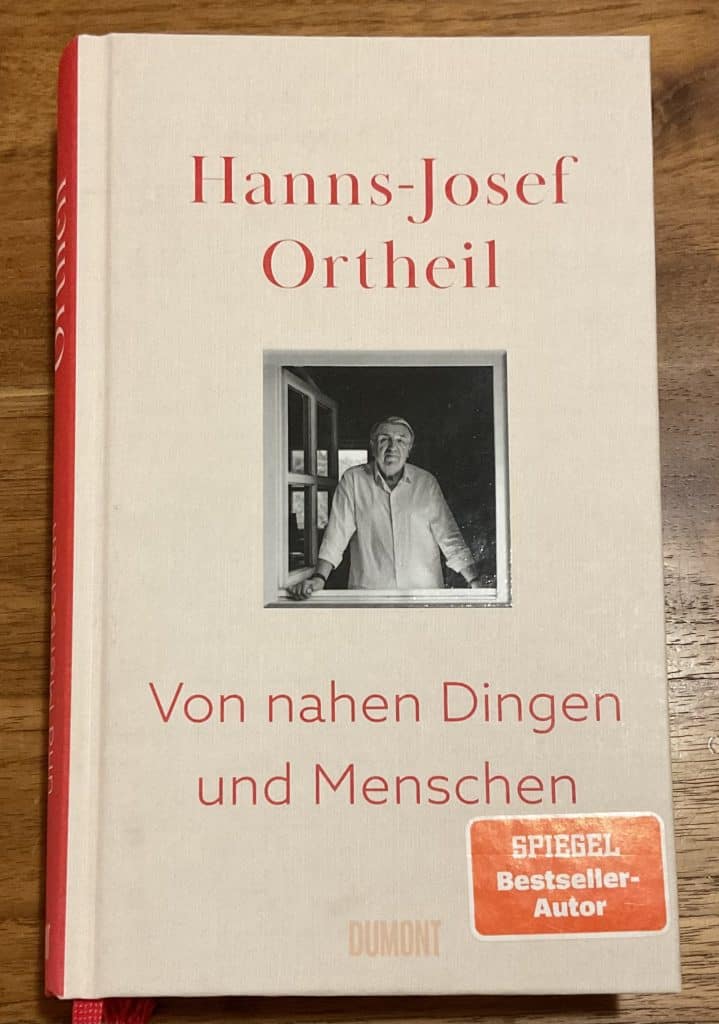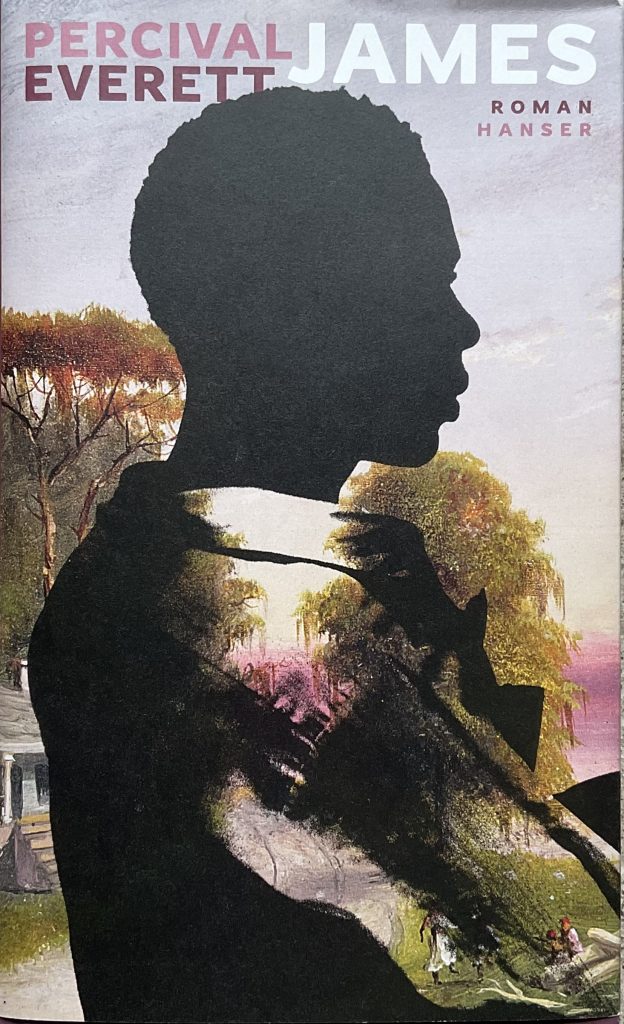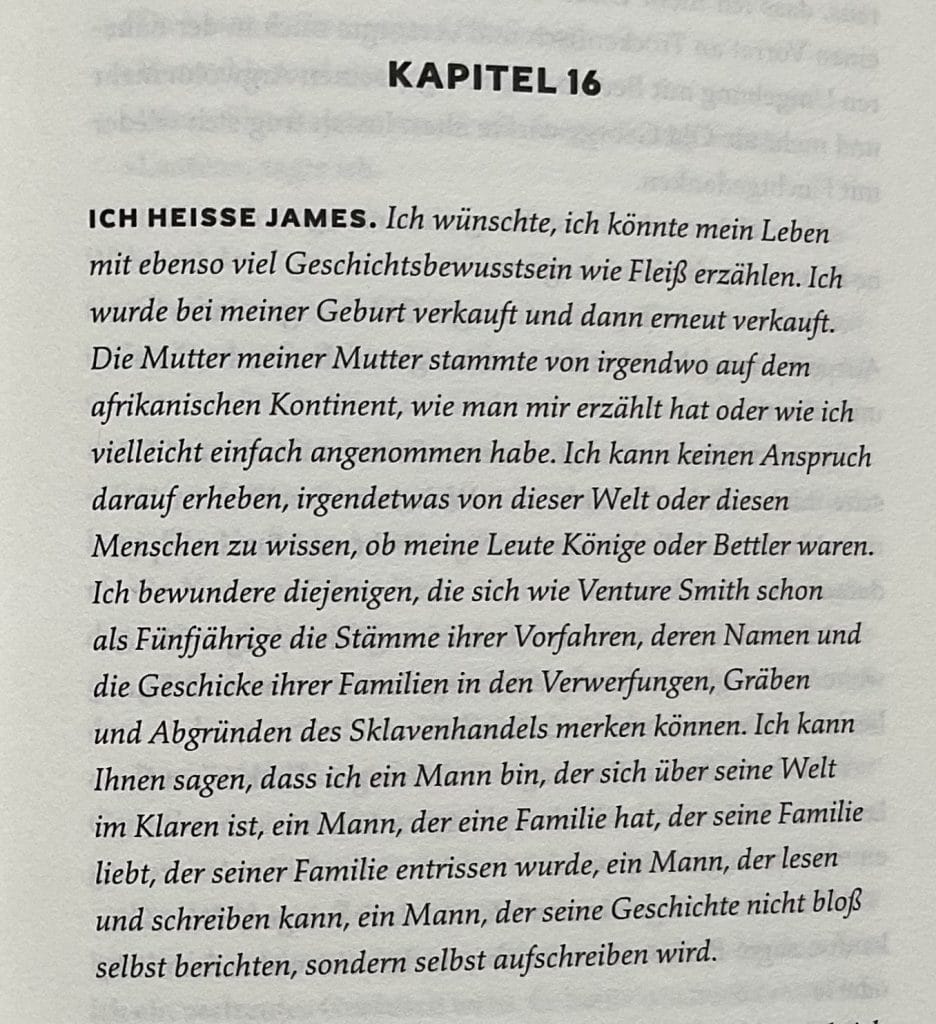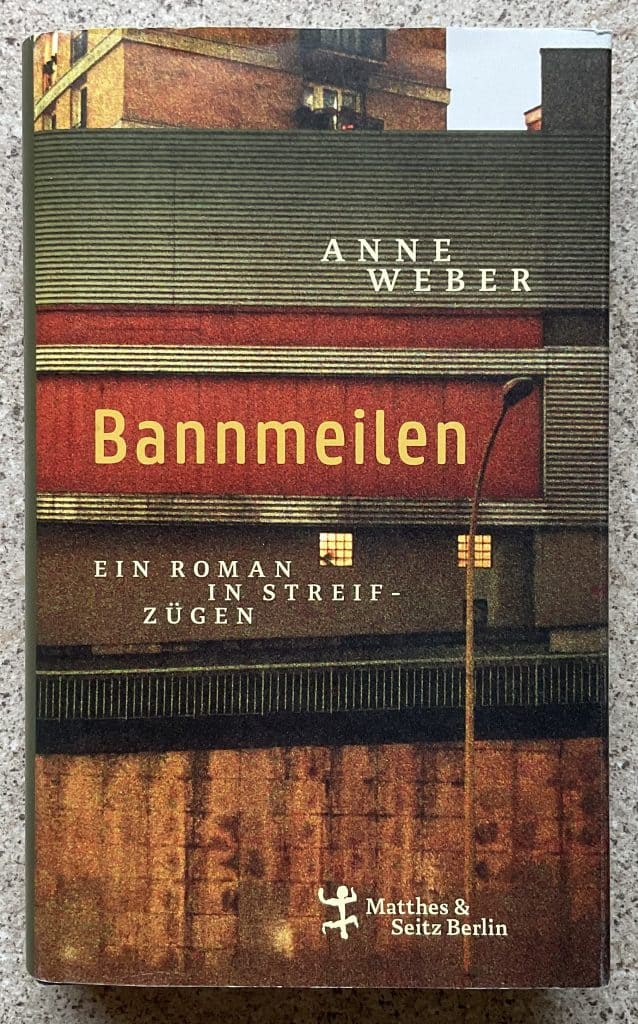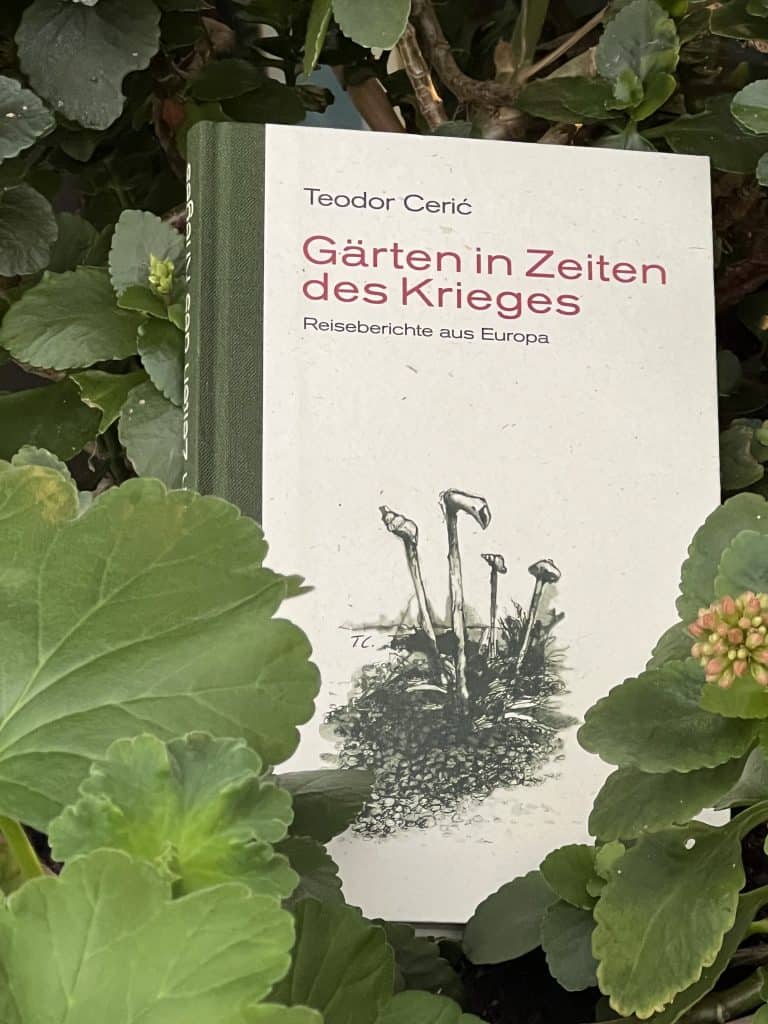Eine kleine Frankreichauszeit muss auch mal sein…Hier eine weitere Urlaubslektüre:

Das Dorf Nincshof liegt an der österreichisch-ungarischen Grenze. Der Bürgermeister und zwei Mitstreiter möchten dafür sorgen, dass das Dorf aus dem Gedächtnis der Allgemeinheit verschwindet. Zu lange haben sich die da oben in Wien schon in die Belange des Dorfes eingemischt und die Herden von Radfahrern im Sommer sind den Herren ein ganz besonderes Dorn im Auge. „Freiheit den Nincsdorfern- Nincsdorf der Freiheit!“ ist der Kampfspuch, der aus einer alten Legende stammt. Ortsschilder werden abmontiert, im Internet Einträge gelöscht, in der nächsten Bibliothek alle Spuren von Nincsdorf entfernt.
Die Drei sind auf einem guten Weg und holen sich als Verstärkung noch Erna Rohdiebl mit ins Boot. Ende 70, hat sie in letzter Zeit subversives Potential bewiesen, als sie heimlich nachts in einem Privatswimmingpool mehrmals schwimmen gegangen ist.
Die Vier, sie nennen sich „Die Oblivisten“, haben Isa und ihren Mann im Visier. Das Ehepaar ist aus Wien neu in das Dorf gezogen. Sie ist Filmemacherin und interessiert sich auffällig für die Geschichte von Nincsdorf, ihr Mann ist Ziegenwirt und züchtet eine ganz seltene Ziegenart. Von den beiden drohen Aktivitäten, die die revolutionäre Bewegung in Gefahr bringen könnten. Ein Film über Nincsdorf, Ziegenberichte im Internet-undenkbar!
Doch dann lernt Erna Isa näher kennen und ihr kommen Zweifel an den oblivistischen Aktivitäten. Sie muss die Männer zur Vernunft bringen, als die Aktionen immer mehr aus dem Ruder laufen- kein leichtes Unterfangen.
Ein intelligenter und humorvoller Unterhaltungsroman, wie ich ihn schon lange nicht mehr gelesen habe.