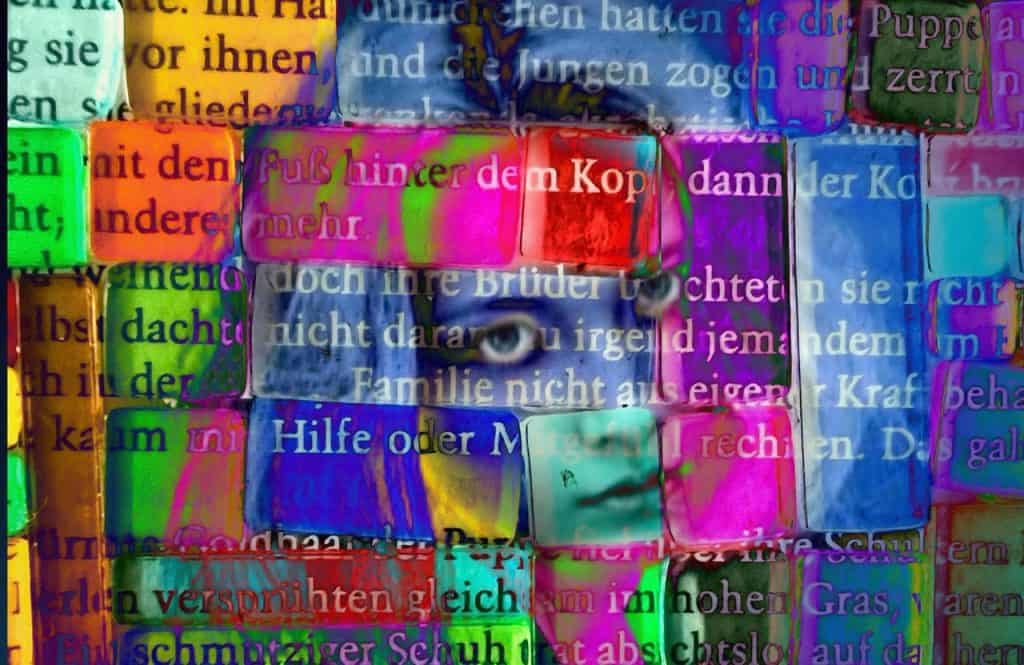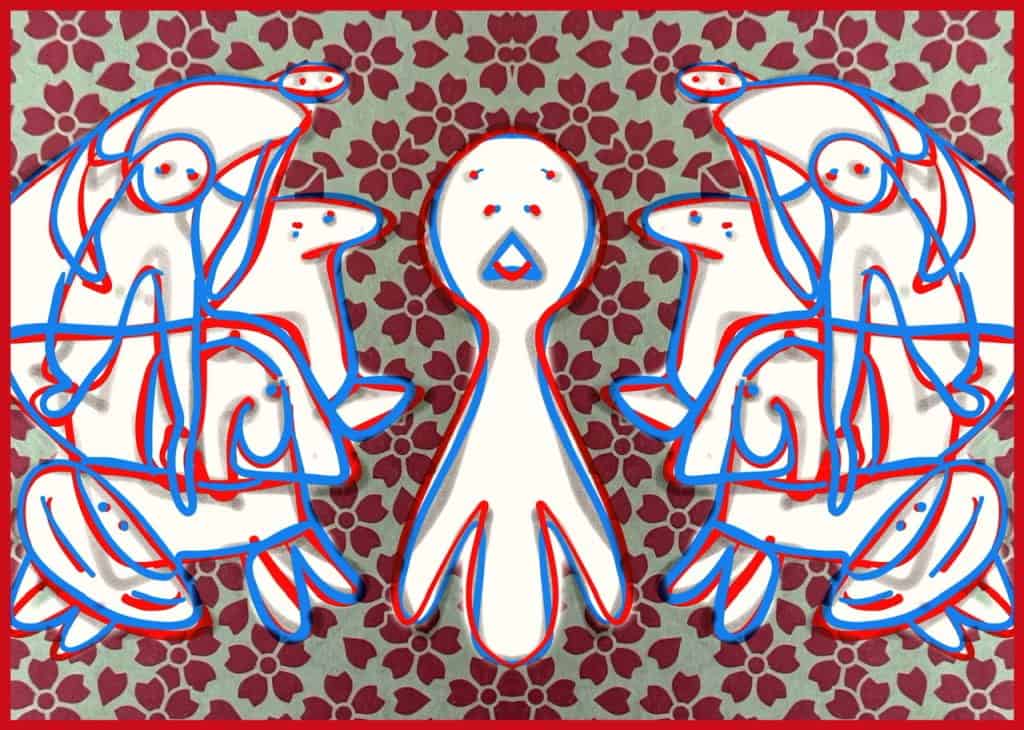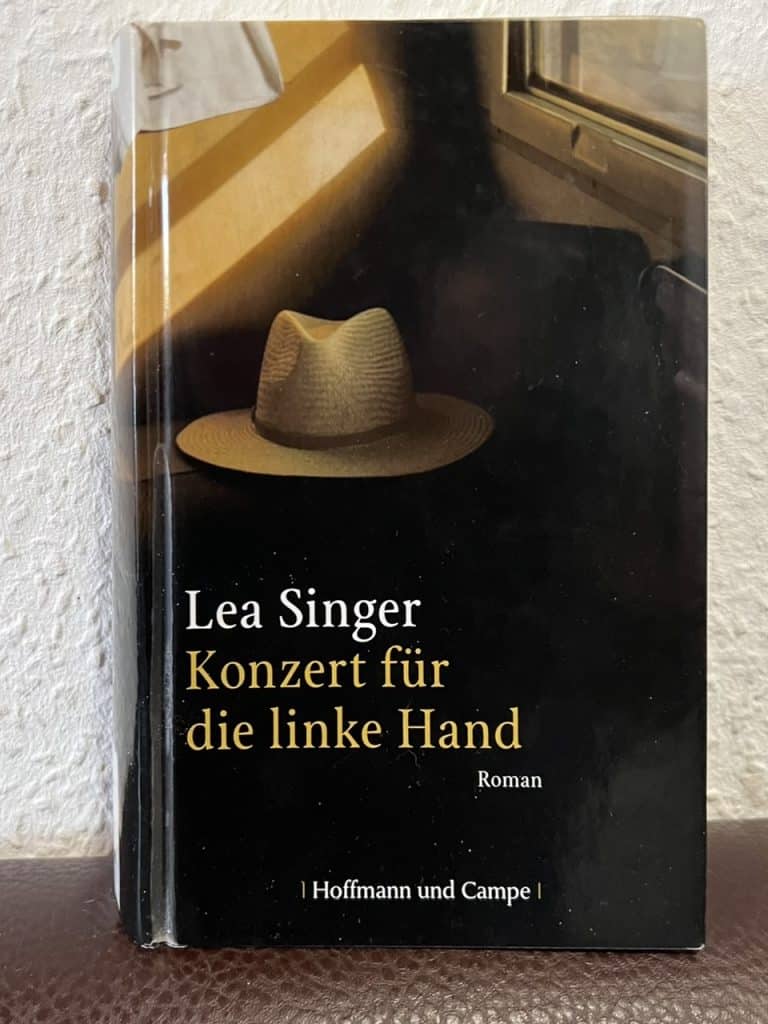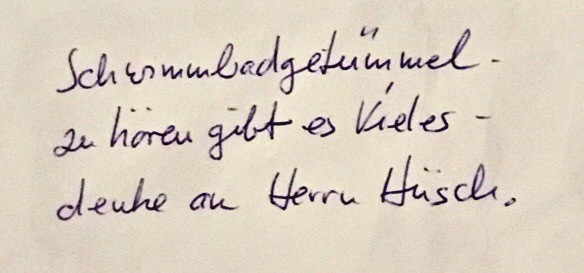Wir schreiben das Jahr 1979.
Der Franzose Jean-Paul Masson reist seit vier Jahren im Sommer zu einer kleinen abgelegenen irischen Insel. Dort sprechen noch einige wenige Bewohner die alte irische Sprache und er will als Sprachwissenschaftler erforschen, wie diese Sprache durch das Englische verdrängt wird. Die Inselbewohner mögen JP und unterstützen ihn, die junge schöne Witwe Mainhead wird seine Geliebte.
Doch im fünften Sommer ist alles anders. Als JP eintrifft, ist er nicht der einzige Gast. Der englische Künstler Mr. Lloyd hat sich einquartiert. Er kommt aus London, seine Frau hat hat eine Kunstgalerie, hält seine Bilder aber schon seit geraumer Zeit für antiquiert. Lloyd hofft, auf der Insel neue Inspirationen für seine Bilder zu finden.
JP und Lloyd wohnen nebeneinander und sind wie Hund und Katze. Lloyd wird von JP bei seiner Suche nach inspirierender Stille gestört, JP befürchtet, dass durch Lloyd die Inselbewohner mehr Englisch sprechen und damit Massons Bestrebungen untergraben werden, dieses Jahr seine Doktorarbeit beenden zu können.
Schließlich zieht Lloyd in eine abseits gelegene Hütte ohne Wasser und Strom. Die meisten Bewohner mögen den Engländer nicht, nur Maeinhead und ihr fünfzehnjähriger Sohn James zollen ihm Respekt und kümmern sich etwas um ihn. So gehen die Wochen dahin und es ergibt sich, dass Meinhead Lloyds Modell wird und James bei ihm zu zeichnen anfängt. Schnell erkennt Lloyd, dass James sehr begabt ist und Insel-und Naturszenen besser darstellt als er selbst. Er will James fördern und ihn mit nach London nehmen, um ihn zur Kunstakademie zu schicken. Auch eine gemeinsame Ausstellung in der Galerie seiner Frau kann er sich vorstellen. James malt wie im Fieber, denn er will weg von der Insel. Er möchte nicht wie sein Vater Fischer werden und eines Tages von einer Ausfahrt nicht mehr wiederkommen.
Die Abreise von JP und Lloyd rückt näher und näher rücken auch die tödlichen Auseinandersetzungen zwischen Katholiken und Protestanten auf dem Festland. Hört man anfangs nur manchmal im Radio eine Meldung, dass wieder eine Bombe gezündet wurde und Menschen starben, häufen sich diese Meldungen im Laufe der Geschichte und gipfeln in zwei Anschlägen, bei denen u.a. Verwandte der Queen getötet werden. Nun ist auch die Insel involviert, denn Einwohner nehmen Partei und die Situation für Lloyd als Engländer wird nicht einfacher. Er muss nur noch sein übergroßes Meisterstück beenden, dann wird er gehen. Das Bild zeigt eine Inselszene mit allen Bewohnern und James erkennt darauf seine eigenen Bilder wieder. Zufall oder Verrat?
Wenn mich jemand fragen würde, was Literatur ist, dann sage ich: „Lesen Sie das Buch „Die Kolonie!“ Die Geschichte, die Atmosphäre des Buches, die Beobachtungen, die Sprache, die angerissenen Themen- perfektes „Material“ für einen Buchclub, in dem Menschen diskutieren und jeder etwas anderes in diesem Roman entdecken wird.